Künstliche Intelligenz, Big Data und der Gedankenstream in meinem Kopf
28. Mai 2019
Quelle: Pixabay
Vor kurzem sah ich auf Youtube die Dokumentation „Modern Stalking – Das Experiment: Wie privat ist dein Leben im Internet?“ von Y-Kollektiv. Ein Journalist wurde dabei begleitet, wie er Passanten auf der Straße nach ihrem Vor- und Nachnamen fragte und in den folgenden Wochen versuchte, so viel wie möglich über diese Menschen herauszufinden. Zunächst suchte er im Internet – Standard, dachte ich mir. Wie oft habe ich selbst schon irgendwelche Schwärme gegoogelt oder einfach Leute, die mich interessiert haben. Meistens habe ich dann etwas über sie herausgefunden und kam mir dabei vor wie eine Stalkerin.
Der Reporter des Y-Kollektivs überschritt bewusst die Grenzen des „gewöhnlichen“ Stalkings im Internet. Er fand die Adressen der Personen heraus, wühlte in deren Müll herum, warf sogar einen Blick in ihre Autos und stieß tatsächlich auf wichtige und vor allem private Daten – alles Daten, die niemanden etwas angehen, außer den Menschen selbst. Und all das fand er lediglich durch den Namen. Namen, die jeder mit Leichtigkeit herausfinden kann.
Ich fand es schockierend, wie einfach es doch ist, sensible und persönliche Daten über jemand vollkommen Fremden herauszufinden. Allerdings gibt man diese Daten in gewisser Weise selbst preis, postet leichtsinnig etwas und denkt sich, das würde schon passen. Großunternehmen wären dumm, diese Informationen und Datensätze dann nicht für ihre eigenen Zwecke zu nutzen – das heißt Systeme zu entwerfen, wie sie die Daten am besten auswerten und ihr Angebot durch diese Erkenntnisse zu personalisieren und für sich zu verbessern. Kann man verstehen.
Jung und Digital
Um genau dieses Thema ging es auch beim zweiten Veranstaltungsteil der Reihe „Jung und Digital“ des Landesjugendrings NRW am 22. Mai in Essen. Big Data, Künstliche Intelligenz – alles Maschinen, die lernen. Daten, die gespeichert werden. Unternehmen, die uns ausnutzen. Ist das denn wirklich so?
Katharina Nocun, Netzaktivistin und Bloggerin, berichtete während des Vortrags von der Recherche zu ihrem Buch „Die Daten, die ich rief“. Sie fragte unter anderem bei Amazon oder Netflix die Datensätze an, die die jeweiligen Großunternehmen von ihr besitzen. Dabei fand sie heraus, dass Amazon anhand ihres Clickstreams, also durch Klicks, die sie auf der Seite von Amazon getätigt hatte, eine Art “Spur” nachverfolgen könne. Diese speichere Amazon und mache damit fast ihr gesamtes Leben rekonstruierbar: Wann sie sich wo befand, sei es im Urlaub, zu Hause, bei ihren Eltern oder aber auch ihre aktuellen Interessen, wie lange sie sich ein Produkt angeschaut hatte und vieles Weiteres.
Irgendwie gruselig. Und durch genau dieses Konzept, die Sammlung wertvoller Daten, ist es Amazon möglich, Werbung auf ihre Kunden anzupassen. Nocun behauptet, Amazon sei bereits so weit, dass es in der Lage sei, Menschen auszutricksen: Eine schwangere Frau bekommt dann zum Beispiel in der Werbung aufgrund ihrer vorher getätigten Gesuche Schwangerschaftsmode oder Babyprodukte angezeigt, daneben aber auch bewusst platzierte Weinwerbung, damit der Verdacht gar nicht erst aufkomme, Amazon würde Werbung auf sie abstimmen. Ganz schön brillant! Doch ist die Lösung dann einfach nichts mehr bei Amazon zu bestellen? Vermutlich. Zugegebenermaßen werden uns genug Alternativen geboten: Der gute alte Supermarkt nämlich oder der Buchladen um die Ecke. Ebenso gibt es Internetseiten, welche von sich behaupten, Daten nicht zu speichern. Ich persönlich bestelle nach wie vor trotzdem bei Amazon – vor allem, wenn es schnell gehen muss. Verzicht muss nicht sein, aber was vorhanden sein muss, ist das Bewusstsein und ein damit verbundener verantwortungsvoller Umgang mit Plattformen großer und vernetzter Unternehmen.
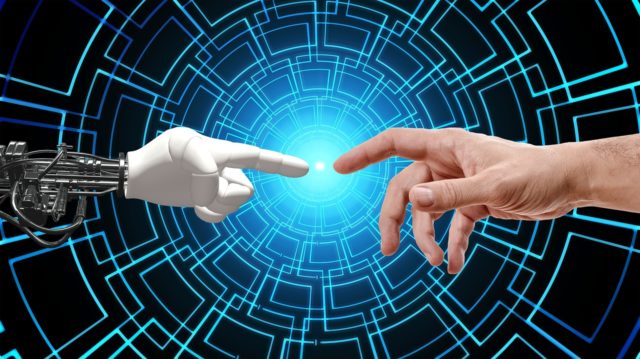
Quelle: Pixabay
Du bist, was du klickst
Auch Netflix sei aber nicht ohne: Nocun erzählt, ihr wurde eine Excel-Tabelle zugeschickt, in der Daten festgehalten wurden, die darüber Auskunft geben, wann sie sich ein Video anschaute, wie lange sie auf welcher Serienanzeige verweilte, wie oft sie sich etwas ansah, an welchen Stellen sie stoppte und welche Szenen sie sich häufiger ansah. Kann das nicht unglaublich viel über persönliche Präferenzen und damit über einen selbst aussagen?
Darüber mache ich mir während des Vortrags viele Gedanken. Wenn jemand wüsste, wonach ich im Internet so suche, google, recherchiere und mich aber nicht persönlich kennen würde… Was würde die Person denken, wer hinter diesen Klicks steckt? Auf Youtube schaue ich mir gern Dokus über extreme Themen an: Impfgegner, Amokläufe, Krankheiten, Demos von Rechtsextremen, Fetische – schockierende und außergewöhnliche Dinge eben. Vermutlich würde man denken, hinter meinen Klicks steckt eine Hobby-Psychologin alias Psychopathin alias komplett Gestörte.
Und genau da liegt meiner Meinung nach das Problem. Maschinen können intelligent sein, sind es aber noch nicht in dem Maße wie Menschen. Kreativität, Gefühle, Einfühlsamkeit, Emotionalität – das lässt sich durch Algorithmen nicht konstruieren.
Notengebung durch Algorithmen?
Dr. Andreas Bischof berichtete, ebenfalls am 22. Mai in Essen, über ein Projekt aus China, von welchem er gehört hatte. Hierbei ging es darum, dass Kameras gebaut wurden, welche alle paar Sekunden von Gesichtern verschiedener Schüler und Schülerinnen in einer Schulklasse Aufnahmen machen. Ein Sensor erkennt den aktuellen Gesichtsausdruck des Kindes und ordnet ihn mit Hilfe von bestimmten Algorithmen einer von fünf verschiedenen Kategorien zu – jede Kategorie steht für eine Stimmung, zum Beispiel fröhlich/motiviert oder traurig/demotiviert. Anhand der Ergebnisse seien Lehrende in der Lage, Feedback der jeweiligen Stunde zu empfangen und zudem anhand des Feedbacks Noten zu vergeben, ganz getreu dem Motto „Wer hat aufgepasst und wer nicht?“.
Der Grundgedanke dieses Systems ist zwar nicht schlecht, ich finde das aber trotzdem falsch. Das Ziel ist ja nicht, dass die Kinder lernen, sich den Kameras anzupassen und Schlupflöcher zu finden, wie sie trotz der Langeweile einen fröhlichen Gesichtsausdruck trainieren, um eine gute Note zu bekommen. Lernen wird dadurch nicht wirklich gefördert.
Grundsätzlich sind Algorithmen mit Sicherheit nützlich und ich finde es auf jeden Fall faszinierend, wie schnell sich die Technik entwickelt. Künstliche Intelligenz ist eine unglaublich interessante Sache und wird sich in den nächsten Jahren rasant weiterentwickeln. Kinder werden noch besser mit Technik umgehen können als jemals zuvor, da das ganze Schulsystem nicht nur maßgeblich durch KI beeinflusst, sondern auch darauf basieren wird: Smarte Geräte in der Schule, keine schweren Schulbücher mehr, die man mit sich herumschleppen muss, vielleicht auch neue Schulfächer wie Programmieren. Das alles können wir vermutlich gar nicht verhindern und das finde ich auch gut so.

Der Mensch – zu komplex, um sich von Maschinen ersetzen zu lassen. | Quelle: Pixabay
Maschinen vs. Menschen – who’s gonna win?
Als ich jedoch vor ein paar Wochen zu einem Seminar in der Uni ging, bei der mir (als Journalismusstudentin) erzählt wurde, dass unser Beruf bald von Maschinen abgelöst werden soll, da wurde mir bewusst: Damit bin ich nicht einverstanden. Das Schreiben ist für mich eine Kunst. Und Kunst entsteht aus Kreativität, die man nicht durch technische Abläufe ersetzen kann. Natürlich haben Berichte einen bestimmten Aufbau: Im ersten Satz alle W-Fragen beantworten, also Ort, Zeit, Person und so weiter. Diese Dinge kann man sicherlich programmieren und es würde auch ein sinnvoller Text dabei herauskommen. Aber es gibt nicht nur Berichte und guter Journalismus geht nur handgemacht. Das glaube ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt– mal sehen, wie sich die Welt noch entwickelt.
Grundsätzlich ist also klar: Irgendwie ist man selbst dafür verantwortlich, wenn man im Internet gefunden wird und wenn man Seiten benutzt, die deine Daten speichern und sie zu ihrem eigenen Vorteil verwenden oder wie man mit KI umgeht. Jedoch hoffe ich, dass uns Menschen mit kreativeren Berufen noch lange erhalten bleiben. Ebenfalls erstaunlich fand ich, mich während dieses Gedankenprozesses zu beobachten: Irgendwie komme ich mir konservativ vor, ganz anders, als in meinem eigentlichen Leben. Als hätte ich Respekt vor Veränderung, als würde ich alles bewahren wollen. Aber mal sehen, was mich erwartet – drum herum komme ich da wahrscheinlich sowieso nicht.
